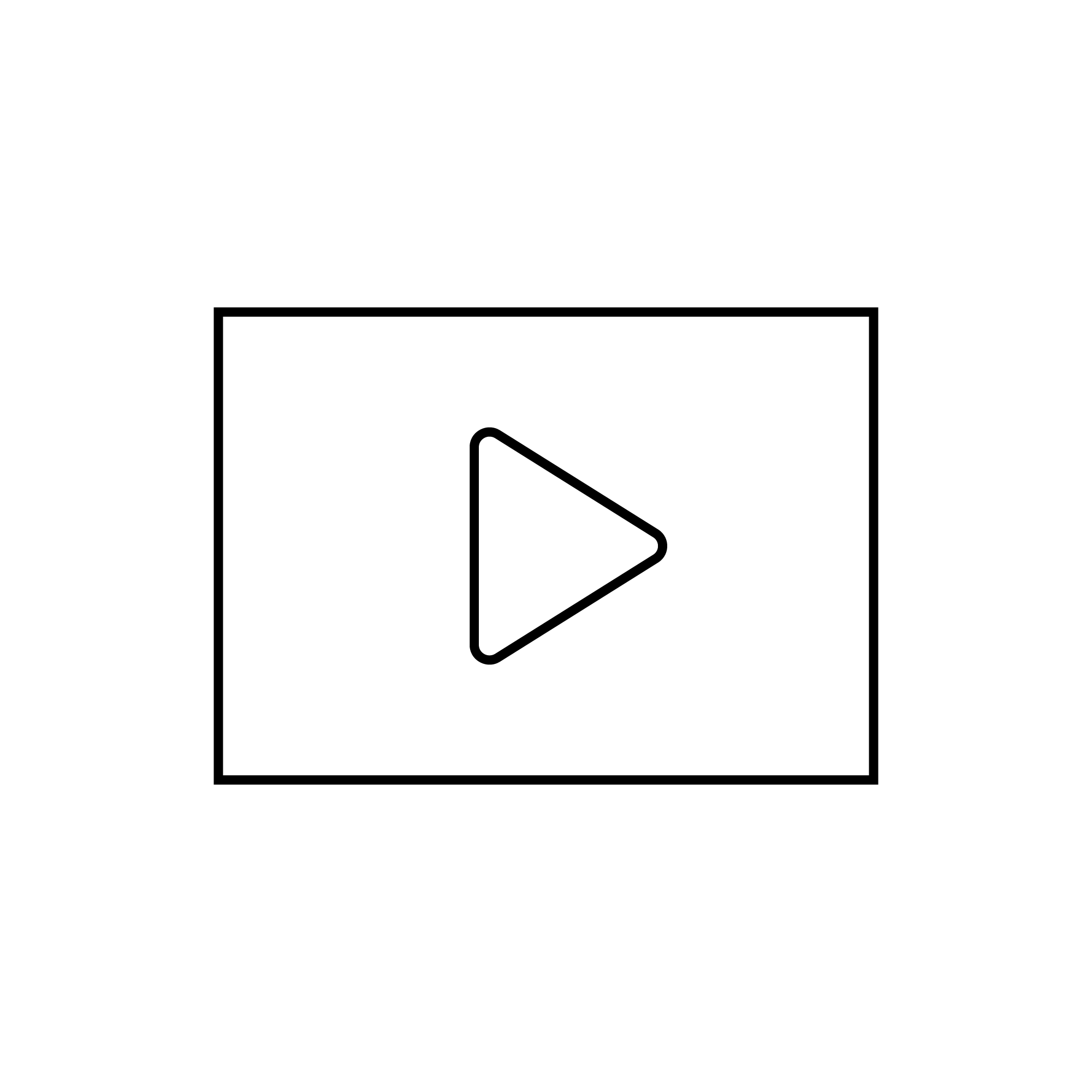Der belgische Kultur- und Designpublizist Max Borka lehrt Design, Kunst und Architektur an der Akademie in Gent, Belgien. Sein unkonventioneller und interdisziplinärer Blick stellt hintersinnig Sinn und Un-Sinn von “Designmessen, -ausstellungen, -biennalen, -zeitschriften, -büchern, -was-auch-immer” in Frage.
„Das Design der Zukunft wird fantastisch, furios, fabelhaft und fabulös. Es wird fanatisch sein und sich mit Superheldenkräften in den Kampf Gut gegen Böse stürzen. Es wird die Frage nach dem Sinn und dem Zweck seines Daseins stellen. Es wird uns den Mittelfinger zeigen, nackt durch den Wald rennen und die Welt retten.“
Jerszy Seymour
Das einzig gute Design wird schlechtes Design sein. Es wird sich sogar allergrößte Mühe geben, so schlecht wie möglich zu sein. Es wird der Tyrannei von all dem den Krieg erklären, was von Konsumgesellschaft und Industrie als gutes Design angepriesen wird: glatt, glamourös, luxuriös, oder einfach praktisch, gutaussehend und höchst verführerisch, aber auch gefährlich, sogar tödlich – „les Formes Fatales“.
Der gute Geschmack von morgen war immer ein Nachkomme dessen, was gestern noch als total geschmacklos galt. Oder, wie der große alte Mann des Anti-Design, Ettore Sottsass, sagt: „Die wahren Neuerungen stammen immer von Huren und Zuhältern“ – ein Statement, das wieder einmal bestätigt wurde, als einige der extremsten kulturellen Phänomene des vergangenen Jahrhunderts, nämlich Vivienne Westwood, ein unbekannter Verbrecher mit dem Namen Johnny Rotten, seine Sex Pistols und der Punk aus Malcolm McLarens „Sex Boutique“ in der King’s Road katapultiert wurden.
Design und schlechter Geschmack schienen geradezu füreinander bestimmt zu sein, als ersteres vor fast zweihundert Jahren als uneheliches Kind geboren wurde – die industrielle Revolution als irgendwie nuttige Mutter mit zahllosen Liebhabern: Physik, Politik, Psychologie, Soziologie, Philosophie, Theater, Dichtung und Krieg, alles dabei, von Adel bis Abschaum. Keiner von ihnen konnte die Vaterschaft für sich beanspruchen, aber sie alle hinterließen während der Bildungsjahre dieses Kindes ihre Spuren. Dies versetzte das Design in die Lage, sich mit einfach allem zu befassen, während sein Status als Bastard ihm die Street Credibility erhielt. Bis das Marketing die Vaterschaft für sich reklamierte, alle Mitbewerber verjagte und den Jungen zu einem selbstgefälligen Dandy machte.
Letzteres kann auch erklären, warum das Design heute beliebter und mächtiger ist denn je. Vor allem in jüngster Zeit weitet sich sein Einflussbereich, gesteuert von der Industrie, immer weiter aus und wird so sehr globalisiert, dass Design ein generischer Ausdruck für all das geworden ist, was unser Dasein in jeder Hinsicht bestimmt – sei es in der Form von Dingen, Vorstellungen, Strategien oder Strukturen.
Im Kielwasser seines Erfolgs wächst die Anzahl an Designmessen, -ausstellungen, -biennalen, -zeitschriften, -büchern, -was-auch-immer, in rasantem Tempo. Die meisten davon sind austauschbar, der einzige Unterschied liegt in ihrer Größe und in den Mitteln, die sie zur Verfügung haben, um ihre Macht zur Schau zu stellen. Sie vermeiden es peinlich genau, irgendetwas auch nur ansatzweise Kritisches zu veröffentlichen, ihre Sprache ist reine Werbung. Als Ergebnis, und parallel zu der geradezu explosiven Eroberung der Welt durch das Design, hat auf semantischer Ebene eine Implosion stattgefunden, die den Designgedanken auf wenig mehr als ein Gleitmittel reduziert, das das kaum verhohlene Hauptziel zu erreichen helfen soll: egal wem egal wie egal was zu verkaufen. Das Mittel ist nur noch so mittel, während seine Bastardhaftigkeit auf ganz neue Weise zutage tritt: das Design ist ein Betrüger.
In den vergangenen Jahren haben einige Geburtsfehler des Designs eindeutig die Oberhand gewonnen. In seiner ewigen Feier des Neuen litt es schon immer unter einem schlechten Gedächtnis. Neuerdings kann man fast glauben, es hätte Alzheimer. Wie Abraham Moles erklärt, teilt es zudem die Menschheit zunehmend ein in solche, die Zugang zu der immer komplizierteren und hermetischeren „Black Box“ von Objekten haben, ihr Funktionieren steuern, und den anderen. Die Logik des ständigen Wandels, die einen schnellen und regelmäßigen Rückfluss der Investitionen erfordert, führte unvermeidlich auch zu einer Überproduktion, einer vorprogrammierten .berflüssigkeit von Waren und einem übers.ttigten Markt – der einzige Ausweg ist ein Wachstum, das auch die Eroberung neuer Märkte erlaubt.
Die Folgen sind nicht nur eine beklagenswerte Verringerung der Design-Qualität und weltweit verheerende soziale und ökologische Auswirkungen, was Arbeitsbedingungen und Müllproduktion angeht, sondern auch – da Design ein typisch westliches Kulturphänomen ist – die vollkommene Verdrängung anderer Kulturen.
Wie Vilém Flusser schreibt: „Die Zukunft wird vor allem eine Frage des Designs sein.“ In der Tat, aber was für ein Design? Die Bedeutung dieses Worts ist so hohl geworden, seit es irgendetwas bezeichnet, dass selbst Experten und Marketingleute es nicht mehr definieren könnten. Und die Antwort lautet: ein Design, das zu seinen Wurzeln zurückkehrt und wieder der glückliche Bastard wird.
Wenn das Design der Zukunft also überhaupt noch zu irgendetwas nütze sein will, wird es unnütz und unschön sein müssen, unbeholfen und unangenehm, unpassend und ungezogen, unvernünftig und unverantwortlich. Es wird eine panorama- und kaleidoskopartige Perspektive einnehmen und eine Vielfalt an Formen bieten müssen, die nicht mehr nur Finanz- und Modefragen folgen – ganz zu schweigen von der Funktion –, sondern auch anderen Wörtern mit F: wie Fiktion und Friktion, Fee und Faun, Freund und Feind, Frucht und Furcht, Frauen und Furien, Fressen und Ficken, Frost und Frust, Funkeln und Furunkeln. Dann wird es wieder fabelhaft und fantastisch.
In einem ungleichen Kampf gegen eine totalitäre esignindustrie wird es sich gezwungenermaßen mit „foco“ und „foquismo“ befassen müssen, der Ideologie, die auf Che Guevaras Postulat zurückgeht, dass eine kleine, entschlossene Gruppe engagierter Männer eine Revolution in Gang setzen kann: mit einer Taktik von Blitzüberf.llen, durch eine gute Mischung von Individuen und Gruppen, die flexibel und mobil sind, immer auf der Suche nach Rissen im System, und die sich ausbreiten wie eine Krankheit, nicht greifbar und nicht heilbar.
Aber die Inspiration wird auch von Menschen wie Peter Sellers kommen müssen, denn die neue Designergeneration wird dieser Radikalität eine gewisse Selbstironie und die befreiende Kraft des Lachens gegenüberstellen müssen. Denn das Foco-Design mag zwar utopisch sein und sich wie Jerszy Seymour in Wunschträumen („pipe dreams“) artikulieren, aber es ist nicht naiv. Es wird vollkommen akzeptieren, dass es keine Flucht gibt vor einer Gesellschaft, in der alles – unser Körper, Essen, Geld, Umwelt, Unterhaltung und Kommunikation – den Konsumgesetzen unterworfen ist, und dass die künstliche die einzig natürliche Umgebung ist. Man wird die romantischen Vorstellungen von einem Zurück zur Natur oder zu einem primitiven Leben wie in alten Zeiten als obsolet erkennen. Das neue Design wird daher auch keine Angst davor haben, seine Ideen in alltägliche oder kommerzielle Produkte zu übersetzen, und auch nicht davor, mit großen Konzernen zusammenzuarbeiten, vielleicht in der vagen Hoffnung, das System von innen heraus verändern zu können.
Wenn man davon ausgeht, dass es die Welt nicht verändern kann, wird dieses „Fait accompli“ als ebenso wirkungslos betrachtet werden und zu dem Schluss führen, dass es, wenn es so wenig zu gewinnen gibt, auch wenig zu verlieren gibt – zumal der Designer heute ein mächtigeres Arsenal zur Verfügung hat denn je. Die höchst raffinierten Waffen werden freundlicherweise kostenlos von der Hauptzielgruppe zur Verfügung gestellt: der postindustriellen Gesellschaft, dem Konsumdenken und dem, was Jean Baudrillard bereits als ihre letzte Metamorphose beschrieben hat, das Hyperreale, eine „Wirklichkeit in Vertretung“, in der Erfüllung und Glück nicht mehr von physischen Objekten oder Kontakten abhängen, sondern von der virtuellen Realität und flüchtigen Simulacra, die die Wirklichkeit zum großen Teil ersetzt haben, vor allem unter dem Einfluss der Massenmedien (Simulacrum bezeichnet eine Darstellung oder ein Abbild, das der öffentlichen Wahrnehmung aufgedrückt wird). Indem ebendiese Medien bis zum Letzten verführt und ausgenutzt werden sowie durch die Schaffung von Simulacra mit mehr Inhalt und Substanz wird der Designer wie der Schmetterling von Edward Norton Lorenz sein, der in Brasilien einmal mit den Flügeln schlägt und damit einen Tornado in Texas verursacht. Nie zuvor konnte ein Designer so viele Entwürfe verwerfen und nie hat er so wenig gebraucht. Ein Laptop und ein Bild reichen heute für eine weltweite Verbreitung. Sein Medium ist nicht mehr das Objekt, sondern auch die Botschaft. Er wird mit der Wahrnehmung spielen, denn um die Wahrnehmung geht es in der Hyperrealität.
Ob man Konsumenten oder Materialien betrachtet, die ganze Designindustrie oder eine einzelne, schlichte Form: die Parole wird „befreien“ lauten. Das neue Design wird weniger Probleme lösen als vielmehr Fragen stellen, denn eine einfache Frage kann an sich schon ein Projekt und eine Leistung sein, und ein großer Teil des Vergnügens wird daraus entstehen, dass das Ergebnis immer offen bleibt. Es wird vor allem die Frage stellen, warum es da ist und worum es geht, einschließlich all der Axiome, die bis heute allen Designstrategien zugrunde lagen: ihre enge Verbindung zur westlichen — amerikanischen und europäischen — Kultur im Allgemeinen, und der industrielle und kapitalistische Apparat, der ihre wichtigste Triebfeder war, im Besonderen. In Zeiten, in denen selbst die größten Konzerne nicht mehr wissen, was sie tun sollen, wird das Design der Zukunft sich nicht mehr damit zufriedengeben, auf ein industrielles Objekt, ein System oder einen Prozess reduziert zu werden, während wir uns nicht mehr damit zufriedengeben, uns wie Konsumenten oder Benutzer zu verhalten. Es wird eine ganze Philosophie sein, die die Systeme, Codes, Konventionen und unterschwelligen Mechanismen überdenkt, die den sozialen Apparat, den Menschen und seine unvermeidlichen Riten und Gebräuche am Laufen und auf Kurs halten. Das Design wird sich darüber hinaus mit der Übervölkerung der Städte beschäftigen, mit der globalen Erwärmung und mit der Kommunikation, die einen kalten Krieg wegen Kleinigkeiten wie schlecht zu öffnender Verpackungen, stumpfer Messer oder stinkender Turnschuhe beenden kann.
Aber als erstes wird es heruntergefahren auf den Nullzustand, die Ursuppe, in der das Chaos regiert, einen Zustand des Nicht-Designs im wörtlichen Sinne, in dem die Dinge noch nicht festgeschrieben sind, um ein neues Alphabet zu entwickeln, mit dem wir unser Wertesystem hinterfragen können, Formbildung überdenken und eine Wissenschaft und eine Praxis entwickeln; die sich mit dem Wohnen und dem Habitat im Allgemeinen beschäftigen, inklusive Favelas und Hütten, und nicht mit Architektur oder dem neusten großen Wurf berühmter Architekten; die sich mit Kleidung und nicht mit Mode beschäftigt; mit Essen, nicht mit Gastronomie; mit Mobilität, nicht nur mit Autos. Es wird sich auf die Phänomenologie des Objekts aufpfropfen, wie sie von Philosophen wie Sartre und Baudrillard entwickelt und von der Designwelt vollkommen ignoriert wurde, und sei es auch nur, weil ihre Kritik Kriterien wie Ekel beinhaltete. Wie eine der Designerinnen in diesem Buch, Katharina Wahl, erklärt: ein guter Stuhl wird dem Kopf mehr bieten als dem Po.
Eine der größten Herausforderungen für das Design wird es sein, neue Wege der Zusammenarbeit zu entwickeln, unabhängig von der existierenden Industrie und unternehmerischem Denken. Es wird dem steten Wandel eine Revolution gegenüberstellen. Wie die Arbeit der wegbereitenden Designer in diesem Buch bereits zeigt, wird das Design nicht für nur eine Ideologie stehen. Es wird auch keine endgültige Antwort liefern. Es wird nicht eins, sondern viele sein. Es wird die Kultur aufmischen und ankratzen – und die Grenzen zu Kunst und Mode, aber auch Wissenschaft, Politik und den extremsten und erbärmlichsten Formen der Popkultur auflösen. Aber das neue Design wird vor allem seine Verbindungen zur Kunst stärken, so wie Boris Groys sie sieht, dass gute Kunst vor allem die Kunst der Weigerung sei: „Heutzutage entwickelt ein erfolgreicher Designer Objekte, die funktional sein mögen, aber gleichzeitig unpraktisch und unbequem sind. Traditionellerweise bedeutete Design eine bequeme Benutzbarkeit, während Kunst nutzlos zu sein hatte. Gutes zeitgenössisches Design verbindet diese beiden gegensätzlichen Figuren miteinander – den nutzlosen Künstler und den praktisch veranlagten Designer (…) und frustriert den Benutzer, der sich fragt, warum der Designer ein so schwierig zu handhabendes Gerät gestaltet hat.“ Statt nur eine weitere Möglichkeit zu sein, den Shareholder zufriedenzustellen, wird dieses „halbfunktionale“ Design vor allem eine poetische Übung sein, die das Blaue vom Himmel holt. Es wird es uns zu allererst ermöglichen, uns selbst zu designen. Mehr denn je werden Objekte zu Vehikeln für unsere Wünsche, Phantasien, Obsessionen, Fetische, Anomalien, Pathologien werden, und vor allem für die „vernachlässigten Bedürfnisse“, die von der Gesellschaft nicht befriedigt oder sogar gemieden werden, wie etwa Noam Torans „Subliminal Furniture“ und „Objects for Lonely Men“. Es wird den unausgesprochenen Ehrenkodex durchbrechen, der die Designer davon abhält, sich auf die dunklen und verstörenden Aspekte des Lebens wie Krieg, Tod, Sex, Terrorismus, Macht, Paranoia, Angst und Autorität, Grausamkeit und Krankheiten zu beziehen und sie zu kommentieren, und davon, Normen und Tabus in Frage zu stellen.
Das Design wird auch zu einer moralischen Frage werden. Es wird Designer mit ihrem politischen, sozialen und ökologischen Gewissen konfrontieren. Es wird auf existenziellen Themen wie Demokratie, globale und lokale Entwicklung, Biotechnologie und Dematerialiserung des Objekts bestehen. Es wird sich einen Weg suchen, auf dem die Vorstellung von Design parallel zur schnellen Globalisierung des Industriedesigns auch semantisch globalisiert werden und sich von einer monokulturellen, ausschließlich im Westen verankerten Angelegenheit in eine multikulturelle verwandeln könnte.
Das Design der Zukunft wird sich weigern, ein Design für ein paar wenige Glückliche zu sein. Im Gegenteil, es wird zuerst und vor allem ein Design für die restlichen 90% sein, die bislang Vergessenen und Vernachlässigten, einschließlich der dritten und vierten Welt. Es wird auch die 90% berücksichtigen müssen, die Enzio Manzini als den Teil unseres gegenwärtigen Verbrauchs von Rohstoffen und Energie benannte, den wir einsparen müssen, um die Welt nachhaltig umweltverträglich zu gestalten. Gleichzeitig fügte er hinzu: Es sei eine der größten Herausforderungen für den Designer der Zukunft, dieses Auskommen mit Weniger und die Armut attraktiv zu machen. Um das zu erreichen, wird das Design der Zukunft eine Vorliebe für schwache, zerbrechliche, bescheidene, unattraktive und höchst ungewöhnliche Materialien entwickeln, die üblicherweise weggeworfen werden, oder an die einfach noch niemand gedacht hat – nicht nur Maschendraht, Klebeband und Pappmaché, sondern auch Sand, Staub und Schmutz, konservierte Schafsmägen, tote Vögel und Maulwürfe, oder gejagte und gefangene Luft und Schatten. Es wird ein Design sein, das sich von der Mitte entfernt und die Peripherie durchsucht, und es wird zu unglaublichen Entdeckungen führen.
Während die Schönheit des Unperfekten gefeiert wird, wird das neue Design zu Victor Papaneks „Design for Need“ und „Design for the Real World“ zurückkehren. Im Kielwasser seiner Appropriate Technology (AT ) und seines „Tin Can Radio“ wird es einen Do-it-yourself-Ansatz propagieren, der das Wesen der Objekte wieder transparent macht. Das neue Design wird uns das nackte Objekt zeigen, auf sein Wesentliches reduziert, frei von Tarnung und überflüssiger Dekoration.
Auf der Suche nach dem Nullzustand wird das neue Design auch im Meer der Dinge, die uns bereits umgeben, im Müll und Junk der Gesellschaft dies und das finden, Weggeworfenes und Verlassenes; es wird Fundstücke ausschlachten, sie mutwillig zerstören, umnutzen, umstellen, dekonstruieren, kombinieren und mit dem Hammer bearbeiten – auch die Ikonen und Klassiker –, um Objekte mit einer neuen Würde zu schaffen, dreidimensionale Poesie.
Das Ergebnis – und die Beispiele in diesem Buch sind bereits zahlreich – werden unterschiedlichste Objekte sein, jedes mit einer eigenen Aussage. Manche werden funktional sein, manche kümmerliche, sonderbare, bekloppte, hybride Monster. Manche vielleicht sogar schön. Aber wie Martin Gamper schrieb, als er aus einem Haufen weggeworfener Stühle in hundert Tagen hundert Stühle machte: „Noch das schäbigste dieser neugemachten Stücke wird eine gewisse Euphorie haben, weil es dem Schicksal entkommen ist.“
Das neue Design wird plötzlich da sein. Der Umgestaltungsprozess ist oft improvisiert, spontan, unmittelbar wie Fronts [nicht gefunden; ist das eine Person? Ein Programm?] dreidimensionale Entwürfe. Traditionelle Handwerkskünste werden mit neusten und modernsten Technologien vermischt und verwandeln mit Hilfe eines 3D-Scanners und einer SLS Rapid-Manufacturing-Technologie einen Strahlenkranz in einen Blitz oder unseren Herzschlag in ein unbelebtes Objekt – wie Tom Price es getan hat [verstehe ich nicht, was meint er? Erklärt sich das anderswo im Buch?].
Aber im Unterschied zum heutigen Design werden die Szenarios, die auf diesen neuen Technologien basieren, nicht Hightech sein. Sie werden vollkommen mit der „diffusen Modernität“ einhergehen, für die ein anderer Doyen der italienischen radikalen Bewegung, Andrea Branzi, plädierte, als er feststellte, dass der klassische Modernismus mit seiner Betonung der geschlossenen Form und definierten Funktion nicht nur den Kontakt zu den intimen Bedürfnissen und dem Verhalten der Nutzer verloren hatte, sondern auch den zu den allgemeinen Bedürfnissen einer in Bewegung befindlichen Gesellschaft, die auf Elektronik und Dienstleistungen gründet. Das zukünftige Design wird auf einer „schwachen Energie“ beruhen, die sowohl der Natur als auch der elektronischen Revolution, die unsere heutige Gesellschaft steuert, gerecht wird, und in der das Transluzente, Leichte, Flexible, Zerbrechliche, Zarte und Poetische die Leitprinzipen sein werden.
Viel zu viele Geräte und M.belstücke sind in unsere Häuser und Büros eingedrungen wie Fremdkörper; technische Gerätschaften ohne jede Würde, die man nur wegen ihres Nutzens schätzt. Die Objekte von morgen jedoch werden den „Animali Domestici“ von Andrea Branzi nicht unähnlich sein; M.belstücken, in denen er das Natürliche und Primitive mit dem technologisch Ausgereiften vermählt; die als Fetische und Meditationsobjekte fungieren, weit über das Rationale hinaus, und die die diffuse Bilderwelt der „dormiveglia“ oder der Tagträumerei spielerisch umsetzen und eine intime und liebevolle Beziehung zu uns aufbauen, ähnlich der zu unseren geliebten Haustieren, Hunden oder Katzen.
In einer Umgebung, die übers.ttigt ist mit Informationen, werden die Objekte der Zukunft keinen Maulkorb mehr tragen, sondern unterschiedliche Kommunikationswege entdecken. Sie werden nicht einfach sprechen, sondern schreien, flüstern, brüllen, rufen und fluchen. Sie werden durch ihre Körpersprache der Persönlichkeit und der Leidenschaft des Designers Ausdruck verleihen und unsere Gefühle und unsere Phantasie wecken – manchmal, indem sie einem Haus schon beim Eintreten etwas Verstörendes verpassen und ein unterschwelliges Gefühl der Beunruhigung verursachen, und manchmal, indem sie uns ein Gefühl einer „Mandorla“ vermitteln, nach der Marti Guixé immer strebt, einer Enthüllung des Sublimen. Zutiefst menschlich, warm, bescheiden, arrogant oder verspielt, werden sie sich nicht als Totems, Menetekel oder Zeichen der Zeit präsentieren und den Geist einer ganzen Ära verkörpern, sondern sich auch selbst als lebende Organismen erweisen, die uns immer wieder mit ihrem Verhalten überraschen, außer Kontrolle geraten und sich permanent verändern.
Zu guter Letzt sind die Objekte der Zukunft kaum mehr als das, was Andrea Branzi als „intelligente Überlebensrequisiten“ in einer postapokalyptischen Zeit beschrieb, und kaum zu mehr nütze als die Karten in den Rückenlehnen von Flugzeugsitzen mit den Anweisungen für den Katastrophenfall, die Marti Guixé als Inspiration dienten. Sie werden daher kurzlebig, vergänglich, flüchtig sein wie Erik Klarenbeeks Seifenblasen und Nacho Carbonells Sandburgen, oder aus kompostierbaren Materialien bestehen, die sich schnell wieder in ihre Umgebung integrieren, eine perfekte Metapher für die Zwecklosigkeit des Designs.
Aber da das Design auch von der Industrie und der Gesellschaft von morgen für zwecklos gehalten wird, wenn auch vielleicht aus anderen Gründen, wird diese Einsicht in seine Nichtigkeit und Relativität auch eine enorme Freiheit schaffen, genauso wie die von Greil Marcus in „Lipstick traces. Von Dada bis Punk. Eine geheime Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts“ beschriebene Erkenntnis, dass alle Dinge „nicht naturgegebene Tatsachen sind, sondern ideologische Konstrukte“. Er beschreibt die Bresche, die Phänomene wie Dada oder die Sex Pistols geschlagen haben: „Dinge, die gemacht worden waren und daher auch verändert oder gleich ganz abgeschafft werden konnten. Es war möglich geworden, Dinge einfach als schlechten Witz zu begreifen, und die Musik als besseren Witz vorzubringen. Die Musik erschien als Nein, das zu einem Ja wurde, dann wieder zum Nein, dann wieder zum Ja: nichts ist wahr, außer unserer Überzeugung, dass die Welt, die wir als gegeben hinnehmen sollen, falsch ist. Und wenn nichts wahr war, dann war alles möglich.“ Anders als gute Kunst – die schon immer vor allem eine Kunst der Weigerung war – war gutes Design immer sehr viel mehrdeutiger in seinem Verhältnis zur Gesellschaft, der Industrie und ihren Bedürfnissen – „ein Nein, das zu einem Ja wird, dann wieder zum Nein, dann wieder zum Ja.“
Das vorliegende Buch vermittelt bereits einen umfangreichen Eindruck, wohin es in Zukunft führen kann, wenn alle gegenwärtigen Dinge als „ideologische Konstrukte“ demaskiert und neue Dinge geschaffen werden, die ganz andere Ideologien atmen, gesteuert von den Interessen der Gesellschaft als Ganzes und nicht nur von der Industrie: üppig, roh, sinnlich, funktionsgestört, frustrierend, leidenschaftlich und mitleidig, liebend und sorgend, wild, extrem, persönlich, phantasievoll und außer Rand und Band. Was auch immer der Titel verheißt: Dieses Buch ist kein Katalog. Es ist irgendetwas zwischen Guevaras „La Guerra de Guerrilla“s, Jacques Tatis „Jour de Fête“, dem Comic „The Fabulous Furry Freak Brothers“ und einer Anthologie besonders herausragender Kurzgeschichten. form will follow foquismo!