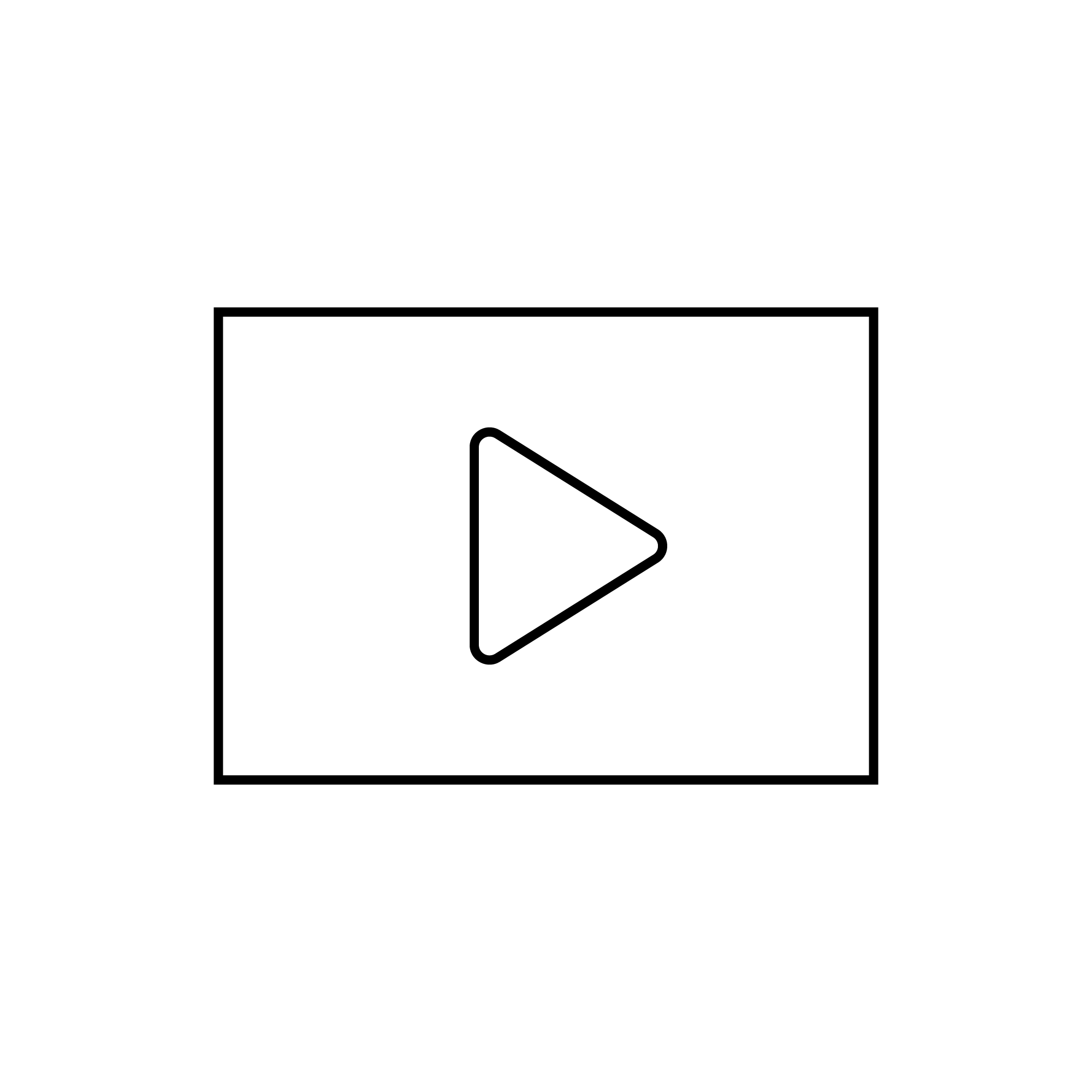Knapp und vieldeutig wie große Literatur beschreibt Paragraph 1 des Abfallgesetzes das Drama des Verbrauchers , der so hilflos-sorglos in den Produkten und Hüllen versinkt, die ihm die Welt bedeuten: “Abfälle… sind bewegliche Sachen, deren sich der Besitzer entledigen will.” Ein Satz, der Fragen aufwirft und Neugier weckt: Wie ist der Besitzer zu den Sachen gekommen? Warum will er sich ihrer so plötzlich und entschieden entledigen, da er doch der Besitzer ist? Wieso sind die Sachen beweglich? Verfolgen sie ihn gar ? Er will sich entledigen, aber kann er auch? Kann dem Manne (?) geholfen werden?
Der Gesetzgeber scheint skeptisch. Guten Mutes ist dagegen die Umgangssprache und jene Abfallstrategen, die den Volksmund neue Worte lehren: Entsorgung ist das Zauberwort. Wenn man sich der beweglichen Sachen schon nicht entledigen kann, so soll man sich doch immerhin der Sorgen entledigen, die sie einem bereiten. Folglich haben wir gelernt, von Entsorgung zu sprechen, statt von Wegwerfen. Das klingt bedacht und verantwortungsvoll, klingt nach einer bewußten Handlung eines mündigen Bürgers, ohne daß diese ihm nachhaltig Sorgen zu bereiten hätte. Das garantiert schon der grüne Punkt, die Lizenz zur unbesorgten Entledigung.
Und so übereignen wir tagtäglich – nicht ohne Skrupel, aber mit Routine – die lästigen Umverpackungen, die Dosen und Hochglanzbroschüren den Wertstoffsäcken und – tonnen der sogenannten Bring- und Holsysteme – geschmeidige Worte für eine Abfallwelt, die immer kreisläufiger und zwangsläufiger zu werden droht.
Doch das Unbehagen bleibt. Wer wollte das leugnen. Seit wir mehr wissen über das komplizierte Vor- und Nachleben der produzierten Güter, ist der Glaube an die totale Entsorgung erschüttert. Voller Wehmut denken wir an an die gute alte Zeit, als man Geschenke noch zwiebelschalenartig verpacken mochte, voller Vorfreude auf die gespannten Gesichter der Adressaten, als schönes Einwickelpapier von den flinken Händen sparsamer Hausfrauen noch feierlich geglättet, Bänder und Schleifen gebügelt und sorgsam verwahrt wurden, als im armen Osten noch edle Verpackungen als Wohlstandsreliquien des Westens auf Borden aufgereiht wurden, als das sorgfältige Fortwerfen von Abfall in öffentlichen Anlagen allein ein Gebot deutscher Sauberkeit und Ordnung und noch kein Akt globaler Unweltverantwortung war.
Nun wissen wir zwar mehr, wissen, daß Papier besser ist als Plastik, Flasche besser als Dose, Abfallvermeidung besser, als Abfalltrennung. Und jedes Kind hat verstanden, daß wir einpacken können, wenn wir mit dem Verpacken nicht bald innehalten.
Doch die Freude an der Verpackung ist geblieben. Wo also anfangen mit dem Bewußtseinswandel? Bei der unverhältnismäßig schweren Transportverpackung Automobil etwa, mit der sich der Mensch mit immensem Energieaufwand aber doch souverän durch die Lande bewegt? Bei den mit jeder Sommer- und Wintersaison wechselnden modischen Hüllen, mit vielen Umweltgiften und bevorzugt in Billiglohnländern gefertigt? Bei den festtäglichen Geschenkeorgien? Oder gar bei Christos Verhüllung des Berliner Reichstags?
Man mag einwenden, das eine hätte mit dem anderen nichts zu tun, Auto, Kleidung und Geschenkverpackung seien grundverschiedene Dinge. Dennoch legitimieren sie sich alle über den Inhalt, dem sie sich dienend unterordnen sollen, den sie tatsächlich aber in ihren ökologischen Begleiterscheinungen überwuchern. Verpackung ist häufig mehr, als der bloße Schutz eines kostbaren Gutes, mehr als Transport- und Lagerhilfe. Sie ist auch ein Kommunikationsmittel, auf das viele kaum verzichten mögen, ob Hersteller und Händler, Künstler und Narzisten, Schenker oder Beschenkte. Vieles läßt sich mit der Verpackung zur Botschaft gestalten: Kaufanreiz und Markentreue, Bewunderung und Gebrauchsanweisung und nicht zuletzt eine ganz persönliche Ansprache.
Da in unserer Zivilisation die Identität eines Menschen und seiner Dinge ganz wesentlich von der Hülle bestimmt ist, wird sie niemand sich so leicht entwinden lassen, erst recht nicht, seit die Ansprüche an sie in Zeiten ökologischer Korrektheit anspruchsvoller geworden sind und damit mehr Raum für individuelle Gestaltung gegeben ist. Die Hüllen sollen nicht fallen, aber sie sollen nach mehr Einklang mit der Natur aussehen, möglichst – in einer Art Mimikry – wie die Natur selbst: Pflanzenfasern, Metall- Holz- und Papierstrukturen stehen auf der Beliebtheitsskala ganz oben – wie einst im Jugenstil. Und wenn das Material der Natur schon so nahe kommt, warum mit den Reizen geizen, warum es nicht so üppig verwenden, wie Mutter Natur selbst? Immerhin ist es ja wiederverwendbar.
Was aus (vermeintlich) natürlichen Materialien hergestellt wurde, kann in der Vorstellung vieler kaum mehr Ressourcen und Energien verbraucht haben, als das unschuldige Ernten der Früchte aus dem Garten Eden. Wer weiß schon die ökologischen Vor- und Nachteile zu bilanzieren, die man mit der Verwendung all jener Materialien eingeht, die den umweltbewußten Ästheten lieb und teuer geworden sind: edle Papiere, unbehandelte Metalle, seltene Hölzer und archaische Textilien, aber auch banales Packpapier und Industriehölzer. Weil sie irgendwie ursprünglich und ungestaltet erscheinen, bedient man sich ihrer gerne, erwecken sie doch den Eindruck von Einfachheit in einer immer komplizierteren Welt.
Unbemerkt sind wir in eine neue Spirale der Abfallgesellschaft geraten. Verpackungen werden nun zwar in ihrer Problematik erkannt. Aber sie werden auch höher bewertet, als je zuvor. Deshalb widmen ihnen Designer und Formkosmetiker, Marketing- und Werbestrategen eine höhere Aufmerksamkeit denn je. Besser täten wir, wenn wir unsere Aufmerksamkeit wieder auf das lenken würden, was – wenn es denn in Form und Funktion gut, das heißt der Umwelt angemessen versorgt ist – nur wenig Umhüllung braucht. Willkommen sind Dinge, die so gut sind, daß sie wenig Verpackung brauchen, und Verpackungen, die so gut sind, daß man sie – wie in alten Zeiten – aufbewahren möchte.